Es ist der erste Tag in einem neuen Jahr, irgendwo in einem Land, das Portugal ähnelt, aber nicht Portugal sein muss. Niemand ist gestorben. Und niemand wird morgen oder übermorgen sterben. Der Tod hat sich abgemeldet. Zunächst ein Grund zur Freude, doch Stück für Stück wird den Bewohnern des Landes das Ausmaß der Katastrophe bewusst. Die einen jubilieren noch ob des ewigen Lebens, das sie erwartet, andere stecken fest zwischen Leben und Tod und ihr Nichtsterbenkönnen führt nicht nur zu viel Leid, sondern auch zum Entsetzen. Dunkle Seiten der Gesellschaft machen ihre Geschäfte mit der plötzlich herrschenden Realität und die Regierung ist ratlos. Auch die Kirche ist in ihren Grundfesten erschüttert, versteht von der Angelegenheit genau so viel wie alle anderen, nämlich gar nichts. Was sie aber natürlich nie zugegeben hätte:
„Die katholischen Würdenträger, vom Bischof aufwärts, fanden die mystischen Witze einiger ihrer nach Wundern dürstenden Mittelständler keineswegs komisch und übermittelten dies den Gläubigern in einer recht entschiedenen Botschaft, in der sie, neben der unvermeidlichen Bezugnahme auf Gottes unergründliche Wege, vehement jene Überzeugung vertraten, die der Kardinal bereits in den ersten Stunden der Krise spontan in dem Telefongespräch mit dem Premierminister geäußert hatte, als er, sich in die Rolle des Papstes versetzend, wobei er Gott für diese törichte Anmaßung um Verzeihung bat, die sofortige Verbreitung einer These vorschlug, nämlich der des verzögerten Tods, im Vertrauen auf die vielfach gepriesene Weisheit der Zeit, die uns versichert, dass es immer ein Morgen geben wird, das die Probleme löst, die heute noch unlösbar erscheinen.“
José Saramagos Stil zwingt den Leser nicht nur zur Konzentration, sondern verlangt auch Durchhaltevermögen. So gut die Geschichte ist, es ist schwer hineinzufinden. Von gliedernder Zeichensetzung hält der Schriftsteller wenig, von manchmal seitenlangen Sätzen dafür umso mehr. Ein linguistisches Meisterwerk und eine Freude für Syntaxliebhaber. Wahrscheinlich allerdings nur für diese.
Jeder Satz nicht nur ein Bild, sondern gleich eine ganze Ausstellung von Metaphern. Surreal und skuril ist diese Zeit ohne Tod und doch fasziniert sie, denn man wird gezwungen, etwas zu Ende zu denken und aus völlig anderer Perspektive zu betrachten, das man bis jetzt nie in Frage gestellt hat.
Interessant ist, dass nur der Tod der Menschen seinen Dienst in diesem Land eingestellt hat, denn Tiere und Pflanzen sterben nach wie vor. Tod ist also nicht einzigartig. Und wie sich schnell herausstellt, auch nicht maskulin. Und sie ändert nach einiger Zeit ihre Taktik. Indem sie die Bevölkerung zwar wieder sterben lässt, dieses Sterben aber exakt eine Woche vorher per Brief ankündigt. Damit löst sie noch mehr Angst und Schrecken aus. Bis einer ihrer violetten Briefe nicht zustellbar ist und sie selbst nach dem Rechten sehen muss. Was sie beim Adressaten erwartet, hätte sie nie erwartet…
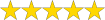 (5,0 / 5)
(5,0 / 5)
