Die Diskussion um die RAF-Terroristen, um ihre eventuelle Freilassung, um Reue oder nicht Reue kocht derzeit so richtig hoch. Weder Brigitte Mohnhaupt noch Christian Klar haben je ihre Abkehr vom „Bewaffneten Krieg“ erklärt, im Gegenteil: Klars Statements sagen einiges aus über die Denkweise des Herrn, er scheint nach wie vor voller Hass auf den Staat zu sein. Was einen Menschen überhaupt so weit bringen kann, eine Institution zu hassen und welche Rolle Kindheit und Jugend dabei spielen, versucht Alois Prinz in seinem (Hör-)Buch „Lieber wütend als traurig“ darzustellen. Er verfolgt das Leben Ulrike Meinhofs bis zurück zu seinen Anfängen.
Ulrike wurde 1934 geboren und verlebte ihre ganze Kindheit vor der schrecklichen Kulisse des Zweiten Weltkriegs. Sie war ein gescheites, aber eher unscheinbares Mädchen, das todernst wirkte, selbst wenn es lächelte. Ein Mädchen, das die christlichen Werte seiner Erziehung verinnerlicht hatte. Zu früh verlor sie ihre Eltern, gewann aber mit der Pflegemutter und Professorin Renate Riemeck eine besonders kluge und emanzipierte Frau als weibliches Vorbild. Schülerzeitung, Studentenblatt – das waren ihre Möglichkeiten, ihre immer wohlüberlegte Meinung kundzutun. Sie wollte verändern, bewegen und sie hasste Gewalt. Klaus Rainer Röhl, Herausgeber der KPD-nahen Zeitschrift Konkret, entlockte der intelligenten jungen Frau die weiblichen Seiten. Sie heiratet ihn, wird Chefredakteurin von Konkret und erwartet Zwillinge, die Aufgrund einer unaufschiebbaren Gehirntumorentfernung allerdings zu früh auf die Welt kommen. Die lange Fehlzeit und die unsäglichen Kopfschmerzen, die Ulrike Meinhof nach wie vor plagen, lassen sie bei Konkret in die hintere Reihe rutschen. Doch Ulrike kann sich mit einer Rolle als Nur-Hausfrau und Mutter nicht abfinden, sie ist und bleibt Vollblutjournalistin und findet nie einen richtigen Zugang zu ihren Mädchen. Schon bald trennt sich Ulrike Meinhof von ihrem Mann, zieht mit ihren Töchtern nach Berlin und lernt dort Menschen kennen, die ihr ganzes Leben auf krasseste Weise beeinflussen….
Wie kann aus einer gläubigen Christin und überzeugten Pazifistin eine Terroristin werden? Welche Rolle spielen Muttergefühle, wenn man seinen ganzen „Besitz“ aufgeben soll? Welchen Stellenwert hat in einem solchen Fall der Druck von außen? Der Einfluss durch andere? Wo liegt der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit?
Auch später, als Namensgeberin der Baader-Meinhof-Bande, galt die inzwischen deutschlandweit bekannte Journalistin als Stimme der RAF. Sie selbst sah sich eher als Drohne, als Arbeitsbiene der Roten Armee Fraktion. Immer wieder musste sie gegen ihre Sehnsucht nach den Kindern ankämpfen, immer wieder kamen ihr Zweifel an der Richtigkeit ihres Tuns und immer wieder spielten Gudrun Ensslin und Andreas Baader entscheidende Rollen in ihrem Leben. Dem Paar fiel es deutlich leichter, sich komplett mit dem „Staatshass“ zu identifizieren. Doch all das ist keine Entschuldigung und wird von Prinz auch nicht als eine solche dargestellt. Er polarisiert nicht, er versucht auch nicht, die Sympathien für Frau Meinhof zu wecken, er erklärt nicht – was er tut, ist ein Bild entstehen zu lassen…. Das Bild einer zerrissenen Frau, die statt des friedvollen einen gewaltsamen Weg wählt, um ihre Überzeugungen durchzusetzen. Die für den Tod vieler unschuldiger Menschen verantwortlich zeichnet, die in Deutschland über Jahre Angst und Schrecken verbreitet hat und deren Tod Fragen aufwirft.
Für Mitdreißiger und Ältere ist die RAF ein Begriff, sie war Thema in der Schule, in den Elternhäusern wurde darüber gesprochen, oft auch diskutiert, manchmal sogar sympathisiert, doch viele Jüngere wissen mit der jetzt wieder hoch gekochten Diskussion wenig anzufangen. Für all diejenigen, die mehr über die Hintergründe wissen wollen, ist dieses preisgekrönte Hörbuch gedacht, denn auch die RAF ist ein Stück deutscher Geschichte.
„Wir haben unsere Eltern nach Hitler gefragt, unsere Kinder werden uns nach Franz-Josef Strauß fragen“
Eva Mattes übernimmt mit ihrer sympathischen rauen Stimme die Zitate aus Meinhofs Leben, Axel Milberg die Erzählerrolle. Es wäre gelogen, wenn man von leichter Kost sprechen würde, selbst, wenn das Hörspiel durchaus auch schon Jugendliche als Zielgruppe im Auge hat. Diese Stunden, die man mit dem Leben und Sterben der RAF-Terroristin verbringt, ziehen viele andere Stunden des Nachdenkens nach sich. Parallelen und Gegensätze zu heutigen Terroristen, Ungläubigkeit gegenüber mancher von Meinhofs Reaktionen, Verständnis für einige ihrer Gedanken….
„Der beste Weg zu verstehen, ist für mich, eine Lebensgeschichte zu erzählen. Gerade für Jugendliche, die oft nicht mehr wissen, was die APO oder die RAF waren, ist das Leben der Ulrike Meinhof ein Stück deutscher Geschichte und eine Geschichte über Utopien – warum sie lebenswichtig sind und warum sie lebenszerstörend sein können.“
Alois Prinz hat bereits mehrere Biographien veröffentlicht, unter anderem über Hermann Hesse und auch die Auszeichnung, die er für „Lieber wütend als traurig“ erhalten hat, ist nicht seine erste. Das Werk ist gut recherchiert, der Autor legt Wert auf zunächst unbedeutend erscheinende Kleinigkeiten, die im Laufe der Zeit an Gewicht gewinnen, doch eines hätte er nicht tun sollen: Den Prolog selbst sprechen. Denn ein Sprecher ist er nicht und die Gefahr, dass das rein stimmlich auf den einen oder anderen abschreckend wirken könnte, ist bei einem Hörbuch doch reichlich groß.
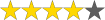 (4,1 / 5)
(4,1 / 5)
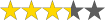 (3,4 / 5)
(3,4 / 5)
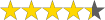 (4,4 / 5)
(4,4 / 5) 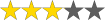 (3,1 / 5)
(3,1 / 5)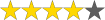 (4,1 / 5)
(4,1 / 5)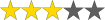 (3,0 / 5)
(3,0 / 5)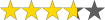 (3,7 / 5)
(3,7 / 5)