‚Eine Geschichte in E-Mails‘ lautet der Untertitel dieses bezaubernden Buches. Dabei ist es so viel mehr. Es ist eine Geschichte der Generationen, eine Geschichte der Errungenschaften der Neuzeit, eine Geschichte über ein pubertierendes Mädchen und ihren kranken Opa, über Frechheiten und Grenzen und eine Geschichte über Abschiede.
Mirjam und ihr Opa schreiben sich E-Mails. Mirjam in ihrer rotzigen und für die Jugend kompromisslosen, Opa in seiner altmodischen und manchmal unbequemen Art und doch finden beide einen Konsens, der sie immer näher zueinanderbringt. „Der Unterschied in der Verrücktheit von vierzehnjährigen Mädchen und beinah achtzigjährigen Männern ist, dass die Mädchen an ihr leiden und die alten Männer sich an ihr vergnügen“, fasst Opa es zusammen und erwartet, wie es zu erwarten ist, Widerspruch. Beide finden Gefallen daran, sich verbal zu duellieren und wie es in unserer schnelllebigen Zeit so üblich ist, hasst Mirjam es, wenn Opas Antwort auf sich warten lässt. Doch eines Tages hat der Großvater einen guten Grund dafür….
Dieses Buch ist eines der schönsten und zugleich traurigsten Bücher der Saison. Glücklich, wer sowohl ein pubertierendes Mädel als auch einen alten Herrn um sich hat – ist er doch nach der Lektüre von „Hallo Opa, liebe Mirjam“ noch tausendmal besser in der Lage, das Überbrücken der Generationenkluft zu bewundern.
Der Autor Peter Härtling ist einer der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit – lang nicht nur im Bereich der Kinderliteratur bzw. der Umsetzung von Literatur für Kinder.
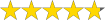 (4,8 / 5)
(4,8 / 5)

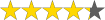 (4,3 / 5)
(4,3 / 5) 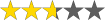 (2,7 / 5)
(2,7 / 5)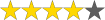 (4,1 / 5)
(4,1 / 5)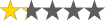 (1,3 / 5)
(1,3 / 5)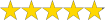 (4,9 / 5)
(4,9 / 5) 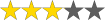 (3,1 / 5)
(3,1 / 5)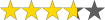 (3,7 / 5)
(3,7 / 5) 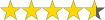 (4,6 / 5)
(4,6 / 5)