Man ist versucht, zu glauben, dass der Erfolg der Biss-Saga nicht zu toppen ist. Ist er vielleicht auch nicht, aber dieses Buch einer jungen Autorin schlägt richtig Wellen – in der eigenen Seele.
Man nennt die Außerirdische ‚Wanderer‘, weil sie bereits so viele Welten durchreist hat, diese Seele, die noch nirgends ein Zuhause gefunden hat. Und das scheint auch auf der Erde so zu bleiben, die gerade von den extraterrestrischen Seelen übernommen wird. Denn sie und ihr Wirtskörper der 17-jährigen Mel kommen nicht wirklich miteinander klar. Mel ist eine Rebellin und lässt sich nicht mal einfach so zum Schweigen bringen, schon gar nicht zum Verlöschen. Sie überlässt dem Wanderer nicht kampflos ihren Körper. Stattdessen quatscht sie dauernd dazwischen und bringt die sie besetzende Seele letztendlich dazu, etwas zu tun, was einer Seele absolut zuwider ist: Vertrauen missbrauchen. doch Mels Grund ist nachvollziehbar. Sie sucht ihren Lover und ihren kleinen Bruder, denen sie versprochen hat, dass sie zurückkommen wird.
Die Menschen machen es der friedfertigen Seele nicht leicht. Entgegen aller Vernunft machen sich Wirt und Seele auf den weg, mit Erfolg. Doch als die beiden Jamie und Jared auftreiben, die mit einigen anderen Menschen versteckt in unterirdischen Höhlen nter der Wüste leben, wird es schwierig. Denn abgesehen von der Abneigung und manchmal auch dem Hass der Gruppe gegen die Seele an sich, machen Wanda, wie sie hier nach einiger Zeit genannt wird, auch die seltsamen Gefühle für Jared zu schaffen. Ihr Körper, dessen Chemie wie verrückt reagiert, sobald er in ihre Nähe kommt, will so gar nicht einsehen, dass die Seele selbst sich eigentlich eher zu Ian hingezogen fühlt.
Das alles klingt jetzt wie eine süße kleine niedliche Lovestory. Ist es, aber nur am Rand. Denn die Handlung dieses Science-Fiction-Romans ist nicht nur spannend, sondern bis ins letzte Detail durchdacht. Auch wenn die Idee der Übernahme des menschlichen Körpers durch Aliens wahrlich nicht neu ist. Doch der Kampf zwischen dem Wanderer und Melanie, der zu Zuneigung und ja gar Aufopferung wird zwischen Wanda und Mel, die Flucht vor der Sucherin, die es – entgegen den Gepflogenheiten ihrer Leute – aus gutem Grund nicht lassen kann, die verlorene Seele zu jagen und die Gefühle zu Ian, die zu einem erneuten inneren Kampf führen – echter Filmstoff. Und weil das so ist, hat Stephenie Meyer ein Zusatzkapitel verfasst, das die Perspektive wechselt. Hut ab vor dieser Story.

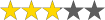 (2,9 / 5)
(2,9 / 5)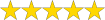 (5,0 / 5)
(5,0 / 5)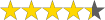 (4,4 / 5)
(4,4 / 5)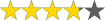 (3,8 / 5)
(3,8 / 5)