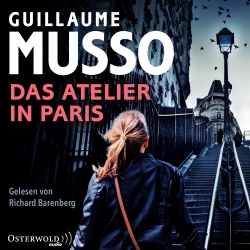Es sind reichlich traurige Figuren, die sich in diesem Roman rund um die Midlife Crisis versammeln – das liegt wohl vor allem am Thema. Hat man da doch automatisch so lächerliche Figuren vor sich wie Männer um die Fünfzig, die nicht mit dem zufrieden sind, was sie haben – obwohl sich das meist deutlich besser gehalten als sie selbst – und die sich stattdessen quer durch alle Betten vögeln. Männer, deren Wampe zwar bereits reichlich unsportlich über die Hose wächst, die sie aber versuchen mit Joggingrunden und sportlichen Wettkämpfen untereinander wieder in den Griff zu bekommen. Und Männer, die sich für klitzekleine Grundstücke riesige Rasenmähertraktoren kaufen, weil sie sich keinen Sportwagen leisten können. Solche Männer halt. Und genau so einer ist Tillmann. Eigentlich glücklicher Familienvater, Besitzer eines Eigenheims und Chef in einer Musterhaus-Siedlung. Doch plötzlich ist ihm das alles nicht mehr genug, er geht fremd und gerät von einer Katastrophe in die nächste. Bis er um Gnade winselnd wieder bei seiner Frau vor der Tür steht. Die nicht weniger als er gegen ihre eigene Midlife-Crisis gemacht hat, aber deutlich subtiler.
Man könnte sie als komisch bezeichnen, diese Geschichte, aber allerdings auch als lächerlich und völlig überzogen. Je nachdem, wie man es sehen will und je nachdem, mit wie vielen Männern in der Midlife-Crisis man es schon zu tun gehabt hat. Aber irgendwie will man dann trotzdem wissen, wie es ausgeht, mit Tillmann und seinen Kumpels, von denen keiner besser ist als der andere. Oder besser: kaum einer.